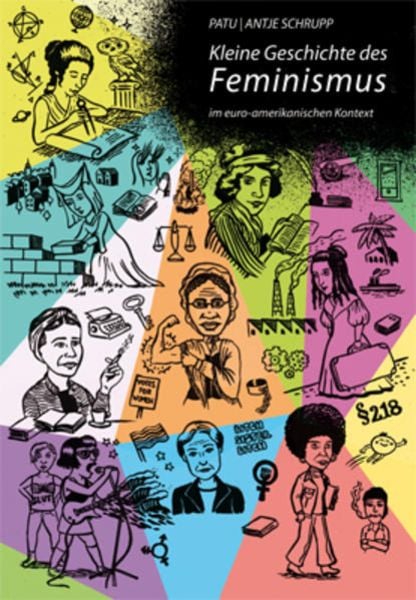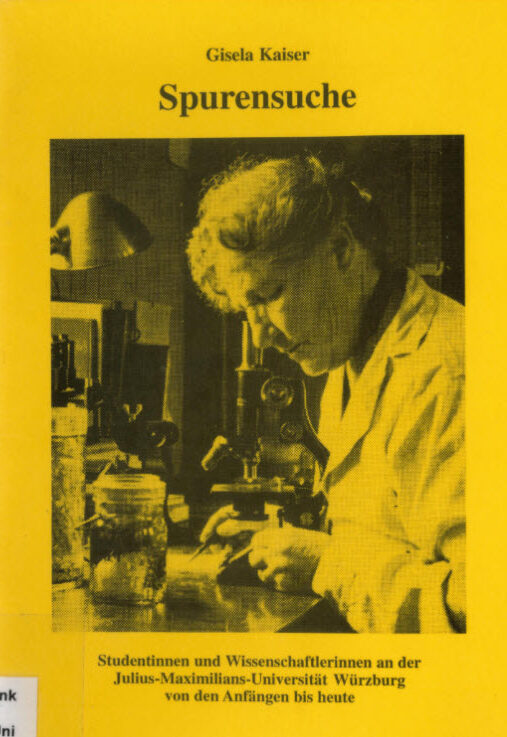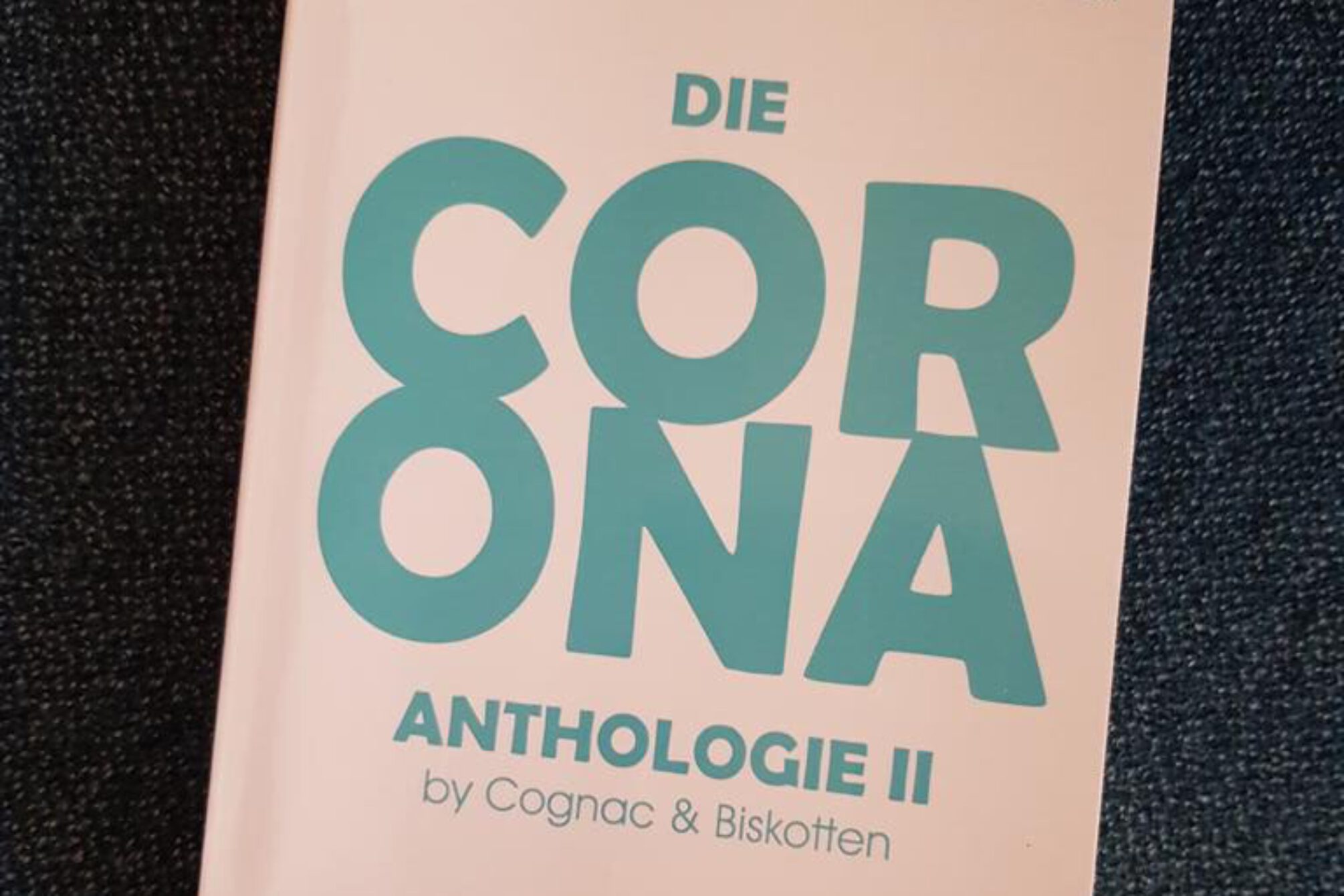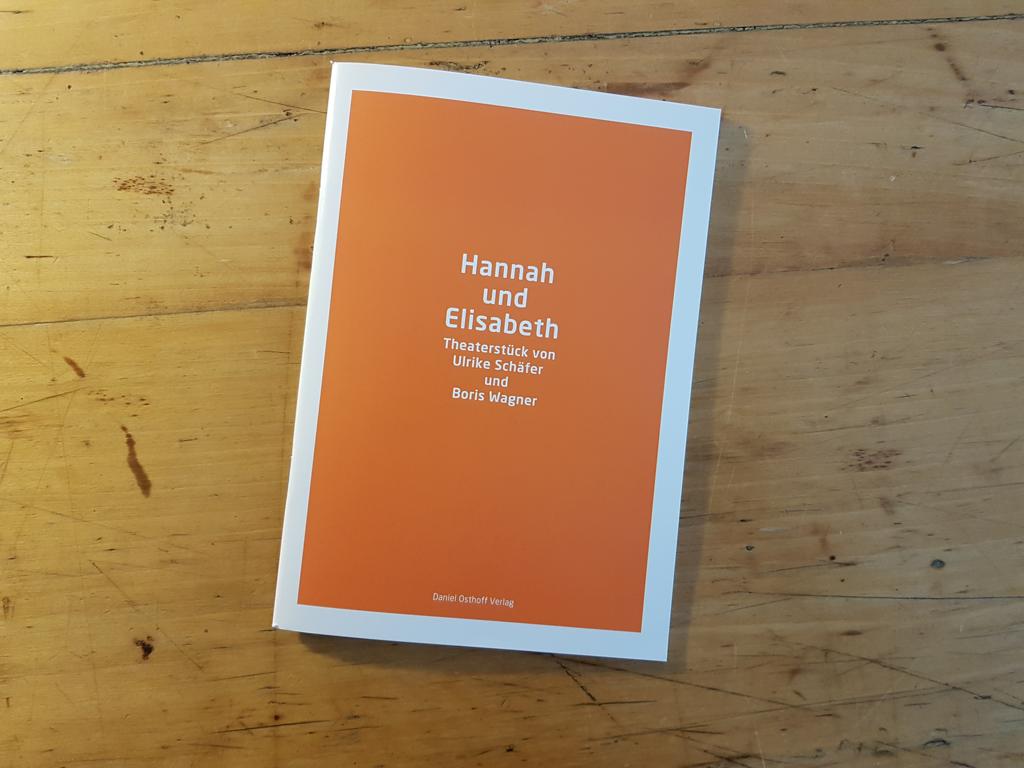Am 21. Juni hatte das Theaterstück „Hannah & Elisabeth“ Premiere. Daniel Osthoff stellte mir aus diesem Anlass einige Fragen, die im Programmheft abgedruckt wurden. Mich haben diese Fragen weiter beschäftigt, deswegen gebe ich sie unten noch einmal wieder und antworte ausführlicher auf sie (hier auch als PDF-Fassung).
Das ist zugleich eine gute Gelegenheit für mich, um mich auf die Zusammenstellung der Schulmaterialen einzustimmen. Denn nach der letzten öffentlichen Aufführung am 4. Juli soll es noch weitergehen: Die Aufführung wurde verfilmt, der Film und das Manuskript werden mit Hintergrundinformationen dazu den Schulen zur Verfügung gestellt – zur Besprechung, für eigene Aufführungen des Stücks oder eigene Produktionen zum Thema. Zu diesem Zweck werde ich demnächst noch mal in die Recherchematerialien zum Stück eintauchen und Auszüge daraus zusammenstellen.
Doch jetzt zu Daniels Fragen und meinen langen Antworten darauf (die immer noch nicht alles enthalten, was mir dazu einfällt – ich hoffe, ich werde das Ganze noch fortsetzen können):
Als wir von „Würzburg liest“ und „pics4peace“ dich fragten, ob du ein Stück über Elisabeth Dauthendey schreiben würdest, das vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart reicht, hast du relativ schnell zugesagt. Gingen dir sofort Bilder durch den Kopf?
Ja, ich sah spontan Elisabeth und eine junge Frau von heute. Die „Story“ war noch nicht da, aber die beiden Frauen, die sich über die Zeit hinweg begegnen, hakten sich sofort fest, noch bevor ich mich entschieden hatte, das Stück zu schreiben.
Nachdem du angefangen hattest, an dem Stück zu arbeiten, kam der Regisseur Boris Wagner dazu, und am Ende firmiert er nun als Co-Autor. Wie kam das?
Boris und ich trafen uns ziemlich bald. Ich war es von meinen beiden Stücken fürs Mainfranken Theater her gewohnt, meine Idee und später auch die Rohfassung mit Dramaturg und Regisseur abzustimmen. Ich komme ja von der Prosa und mag das an der Theaterarbeit sehr, dass der Text im Dienst eines Gesamtwerks steht und unterschiedliche Professionen – Autor:in, Regisseur:in usw. – aus verschiedenen Blickwinkeln heraus darauf schauen. Ich suche diese Zusammenarbeit auch, weil meine Ausflüge ins Theaterschreiben ja sporadisch sind und mir das Sicherheit gibt, dass da etwas „Inszenierbares“ entsteht.

Mit Boris wurde es dann die engste Zusammenarbeit bisher, das hat sich organisch so ergeben. Boris stieg sofort auf meine Idee der zweiten weiblichen Hauptfigur ein und konnte auch mit meiner Vorstellung zur „Aussage“ des Stücks viel anfangen. Ich zeigte ihm ein paar Story-Ideen, die schlussendliche Grundidee und ein erster grober Szenenplan stammen aber von ihm und haben mich wiederum sofort überzeugt. Den Szenenplan haben wir dann gemeinsam angepasst und weiterentwickelt und könnten heute gar nicht mehr sagen, von wem welche Ideen darin stammen. Vieles entstand gerade in diesem Austausch miteinander.
In die konkrete Ausgestaltung floss anschließend sehr vieles, was sich aus meiner umfangreichen Recherche sowohl zu Dauthendey als auch zur heutigen Zeit speiste. Den Text geschrieben habe ich, aber auch hier waren wir – allein schon wegen des taffen Zeitplans – von einer sehr rohen Fassung an im Austausch und gingen den Text am Ende Satz für Satz durch – was wir so gar nicht geplant hatten, was wir aber dann ebenfalls spontan als die beste Vorgehensweise empfanden.
Dieser gemeinsame Prozess hat sich für uns beide als sehr produktiv erwiesen. Rein zeitlich hatte ich in dieser Phase zwar den weitaus größten Anteil, aber keiner von uns hätte allein dieses Stück geschrieben, das war ein echtes Gemeinschaftswerk.
Eine Figur wie Elisabeth Dauthendey, über die es leider nicht sonderlich viel Biografisches gibt, war sicherlich nicht einfach zu fassen, oder?

Das war, ehrlich gesagt, das einfachste, weil ich mir maximale Freiheit genommen habe: Elisabeth im Stück ist eine fiktive Figur, die sich biografische Fakten und – vielleicht – Charakterzüge von Elisabeth Dauthendey leiht.
Beim Charakter habe ich mich von der Energie und Wut leiten lassen, die aus ihren Essays „Unweiblich“ und „Geschlechter“ strömen. Weiteres habe ich aus der Recherche geschöpft, z. B. auf welche Weise das Thema Recht und Jura eine Rolle spielt.
Daraus ergaben sich deutliche Abweichungen von realen Personen und Begebenheiten, aber gerade zu dem Zweck, in der verdichteten Form der Fiktion etwas Wahrhaftiges über diese Zeit und die Hindernisse zu erzählen, die die Frauen zu überwinden hatten, sowohl in Würzburg als auch darüber hinaus.
Auch da war die Zusammenarbeit mit Boris ein Glücksfall, weil er mich darin bestärkt und meine zwischenzeitlichen Skrupel, was die biografischen Abweichungen betrifft, ausgeräumt hat.
Elisabeth Dauthendey gehörte zu den ganz frühen Frauenrechtlerinnen in Würzburg im ausgehenden 19. Jahrhundert. Sind ihre Forderungen vergleichbar mit denen, die heutige Feministinnen aufstellen?
Wenn ich mal einen weiten Bogen schlagen darf, bevor ich das beantworte: Elisabeth Dauthendey steht ja selbst schon in einer jahrhundertelangen Reihe. Wer einen ganz kurzen und zugleich präzisen, einordnenden Überblick bekommen möchte, dem empfehle ich den Comic „Kleine Geschichte des Feminismus“ von Patu und Antje Schrupp.
Auch der Kampf um weibliche Bildung und Berufstätigkeit reicht weit zurück. Bei der Recherche hat mich z. B. eine Forderung des Allgemeinen Deutschen Frauenbildungsvereins von 1865 geflasht (da war Dauthendey gerade einmal 11 Jahre alt): „Befreiung der weiblichen Arbeit von allen ihrer Entfaltung entgegenstehenden Hindernissen“. Das ist sicherlich heute noch aktuell, inklusive der neoliberalen Vereinnahmung dieser Forderung.
Aber auch in Würzburg gab es mindestens über Jahrzehnte hinweg immer wieder Versuche, den Frauen Zugang zu Bildung zu verschaffen. Das kann man sehr gut nachlesen bei Gisela Kaiser: „Spurensuche. Studentinnen und Wissenschaftlerinnen an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg von den Anfängen bis heute“. Frauen in Würzburg haben z. B. 1869 schon einmal einen Antrag auf Zulassung zur Universität gestellt, der vom Senat abgelehnt wurde. Auch einzelne Frauen haben es immer wieder versucht.
Was Elisabeth Dauthendey selbst betrifft, so haben mich ihre Essays „Unweiblich“ und „Geschlechter“ unmittelbar berührt, sowohl im Kopf als auch emotional. Ebenso vieles in ihrem Buch „Vom neuen Weibe und seiner Liebe“. Vieles davon hat aus meiner Sicht Bezüge zu heute.
Ein Gedanke taucht bei ihr öfter auf:
„Sie (Mann und Frau) müssen sich erst zueinander entwickeln. Das Weib hat den ersten Schritt dazu getan.“
Elisabeth Dauthendey: Vom neuen Weibe und seiner Liebe, S. 26
Sie fordert also ein, dass auch die Männer sich bewegen und dass Frauen und Männer sich sozusagen an einem neuen gemeinsamen Ort treffen. Ich denke, das ist heute sogar sehr aktuell, und letztlich war dieser Gedanke der Grund, warum ich zugesagt habe, das Stück zu schreiben.
Insbesondere erinnerte es mich an das, was ich „die Tücken der Gleichstellung“ nenne und was ich zum ersten Mal bei Antje Schrupp entdeckt habe. Das folgende Zitat von ihr stammt aus einem Vortrag 2009 und ist heute noch aktuell:
„Ich denke (…), es ist an der Zeit, den Terminus „Gleichstellung“ grundsätzlich in Frage zu stellen. Denn allein dieses Wort bedeutet schon eine Kapitulation aus Sicht der weiblichen Freiheit.
[An dieser Stelle des Artikels ist ein Comic von Patu abgebildet, in dem eine Frau sagt: „Frauen und Männer müssen gleich sein.“ Und eine andere Frau fragt: „Gleich den Männern oder gleich den Frauen?“]
Die Antwort, so wie wir sie in den letzten 20 Jahren präsentiert bekommen haben, ist klar: gleich den Männern. Ganz automatisch haben wir uns angewöhnt, den Maßstab für die Frauen dort anzulegen, wo die Männer sind. Das, was sie machen, ist normal. Und die Frauen müssen sich dem angleichen – solange das nicht gelingt, liegt etwas im Argen.“
Antje Schrupp: Die Freiheit der Frauen in einer gleichgestellten Welt
Als ich das zum ersten Mal las, fiel es mir wie Schuppen von den Augen, auch was meine ganz persönliche Erfahrung betrifft: Das war der Anpassungsdruck, den ich selbst verinnerlicht, aber nicht verstanden hatte. Besonders war er mir von meiner IT-Laufbahn her vertraut. Er erzeugte einerseits das Gefühl, dem Anspruch, wie ich zu sein hatte, sowieso nicht genügen zu können. Und andererseits merkte ich, dass ich das eigentlich auch gar nicht wollte – was ich mir selbst wiederum als Schwäche auslegte. Dieser unverstandene innere Zwiespalt führte zu einem immerwährenden Kräfteverschleiß.
Ich glaube, diesen Zwiespalt kennen viele Frauen. Und ich habe den Eindruck – auch nach der vertieften Recherche zu diesem Stück -, dass die Falle des männlichen Maßstabs und die Frage, wie weibliche Freiheit jenseits der „Gleichstellung“ eigentlich aussehen kann, aktuell von vielen Frauen für viele Bereiche untersucht wird.
Insofern hat sich seit den Anfängen der „Gleichstellung“ einiges getan. Während meiner IT-Zeit stieß ich z. B. auf ein Buch „Hardball for Women“ – das muss in den frühen 2000ern gewesen sein – mit Empfehlungen, wie man sich als Frau in der Berufswelt „harte männliche Verhaltensweisen“ antrainiert. Heute weisen das viele zurück und stellen die Frage, was davon eigentlich gut und gesellschaftlich nützlich ist und welche wir – auch die Männer – hinter uns lassen sollten.
Hilft der Blick in die Vergangenheit die gegenwärtigen Probleme zu verstehen?
Er hilft, die Tiefe des Problems zu verstehen.
Institutionen wie die Universität etwa sind unter explizitem Ausschluss von Frauen entwickelt worden (und dieser Ausschluss wurde lange und aggressiv verteidigt, wie die teils wörtlichen Zitate im Stück illustrieren). Unter welchen Bedingungen würden wir heute Forschung treiben, wenn wir eine gemeinsame Wissenschaftsgeschichte hätten? Würden wir z. B. auf die Idee kommen, dass die Weichen für wissenschaftliche Karrieren ausgerechnet in dem Lebensalter gestellt werden, wenn Menschen kleine Kinder haben? Gäbe es überhaupt „Karrieren“? Hätten wir die gleichen Forschungsschwerpunkte, wenn die Lebenserfahrung aller in bewusste und unbewusste Entscheidungen einfließen würde?
Das können wir nicht beantworten, aber wir sollten so grundlegend fragen. Wenn man sich klarmacht, dass solche Institutionen auf Diskriminierung und damit auch Abspaltung und Ausblendung ganzer Lebensbereiche gründen, dann versteht man besser, warum Gleichstellungsmaßnahmen – „Frauen dürfen jetzt auch dies und jenes“ – oft so unzureichend greifen. Und dass man diese Institutionen nicht durch ein paar Fördermaßnahmen „frauenfreundlich“ machen kann, sondern sie im Grunde neu erfinden muss.
Hannah, die moderne Frau in deinem Stück, trifft auf Elisabeth. Treffen da zwei Welten aufeinander?
Ich habe mich oft gefragt, wie es wohl „wirklich“ wäre, wenn Elisabeth Dauthendey eine heutige Frau träfe. Mit Sicherheit ganz anders als im Stück, und wahrscheinlich würden da in noch viel stärkerem Maße zwei Welten aufeinanderprallen.

Aber auch im Stück müssen die beiden eine große Hürde überwinden. Zunächst hat es den Anschein, Hannah komme aus derjenigen Zukunft, die Elisabeth sich erträumt hat. Dann wird deutlich, dass das nicht so ist, und daraus entstehen Konflikte zwischen den beiden, die wir heute auch kennen, etwa zwischen älteren und jüngeren Frauen:
Bei der Bewegung #aufschrei vor 10 Jahren, die Alltagssexismus als gesellschaftliches Massenphänomen sichtbar machte und anprangerte, hat sich das z. B. gezeigt. Unter den älteren Frauen gab es manche, die sagten: Habt euch nicht so. So sind die Männer halt, da muss man sich eben durchbeißen. Es gibt in den älteren Generationen also einen gewissen Stolz, es trotz allem geschafft zu haben. Das ist biografisch verständlich, für die Jüngeren aber kein Zukunftsmodell. Die akzeptieren dieses „Trotz allem“ nicht mehr.
Auch Hannah und Elisabeth müssen sich erst zueinander bewegen und gemeinsam herausfinden, was eigentlich das Problem ist.
Worin siehst du heute die größten Probleme für die Gleichberechtigung von Frau und Mann?
Da kann ich an meine Antwort weiter oben anschließen: Das Grundproblem sehe ich darin, dass wir alle in eine bis in die Haarwurzeln patriarchal und androzentrisch geprägte Welt hineingeboren wurden und irgendwie darauf aufbauen und damit umgehen müssen.
Im Grunde müsste man die Welt neu verhandeln. Aber das geht natürlich nicht, wir können ja nicht die Pausetaste drücken und alles neu aufbauen. Also haben wir Gleichstellungsmaßnahmen, aber die beinhalten das Problem oder zum mindesten die Gefahr, dass der althergebrachte männliche Maßstab als Zielpunkt, den Frauen „jetzt auch“ erreichen dürfen und sollen, bestehen bleibt.

Ich denke, das ist weiterhin die größte Herausforderung: dass man beides zugleich machen muss, konkrete Maßnahmen, die konkrete Lebensverhältnisse im Gegebenen erleichtern – z. B. die Situation junger Wissenschaftlerinnen, die Mütter werden -, und das Gegebene zugleich radikal in Frage stellen und um grundlegende Änderungen ringen.
Am eklatantesten zeigt sich das im Care-Bereich. Das ist ja auch logisch: Man kann nicht von einer Gesellschaft, die die gesamte Care-Arbeit, allem voran die Sorge um Kinder – unbezahlt – den Frauen überlässt, zu einer Gesellschaft übergehen, die den Frauen Zugang zu Erwerbsarbeit, Politik, der ganzen öffentlichen Sphäre gewährt, ohne diese Gesellschaft und ihre Institutionen, aber auch die Care-Arbeit selbst, ihre Organisation und ihren Stellenwert, grundlegend zu ändern, und ohne dass sich auch für die Männer Grundlegendes ändert. Stattdessen gibt es Maßnahmen für Einzelprobleme, die aber kein Gesamtkonzept ergeben. Aber dieses Thema verdient noch mal eine eigene Würdigung, die ich später nachschieben muss.
Es kommt jedenfalls nicht von Ungefähr, dass das erste Thema, das mich bei der Recherche zur heutigen Situation der Frauen an den Universitäten angesprungen hat, genau dieses war: Die Universitäten verlieren die meisten jungen Wissenschaftlerinnen dann, wenn diese Mütter werden. Da geht die Schere auseinander, d. h. ab da passt die Institution Universität, so wie sie heute (immer noch) ist, nicht gleichermaßen zu den Lebensverhältnissen von Frauen und Männern.
Ist die Frage der Gleichberechtigung eine nie endende Geschichte?
Meine spontane Antwort? Ja. Leider.
Allein schon dieses gigantische historische Erbe, von dem wir ja nur einen Wimpernschlag entfernt sind, macht es so unglaublich schwer. Ich könnte jetzt Zahlen bemühen, zum Beispiel Prognosen, wie viele Jahre der Gender Pay Gap noch fortbestehen wird. Aber spontan kommt mir ein ganz anderes, alltägliches und vermeintlich banales Beispiel: Wenn ich durch den neuen Stadtteil „Am Hubland“ gehe und die Straßenschilder lese, wird mir immer ganz elend. Ich weiß nicht, ob es dort überall so ist, aber an der Ecke, durch die ich öfter laufe, ist es wie eh und je: Ein Männername nach dem anderen.
Das ist die Selbstverständlichkeit, die uns umgibt. Das ist die Welt, in die Kinder heute und Jahrzehnte nach heute hineingeboren werden, Mädchen wie Jungen. Lange bevor sie eine Haltung dazu einnehmen können, ja bevor sie es überhaupt bemerken, werden sie diese Botschaft in sich aufnehmen: welches Geschlecht Relevanz trägt und Erinnerung verdient.
Diese frühen Prägungen sind vielleicht das schlimmste, weil sie unbewusst stattfinden. Und da ist einfach kein Ende abzusehen. Oder anders gesagt: Wir stehen noch ganz am Anfang.
Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns fragen, wie wir mit diesem historischen Erbe, diesem gigantischen Berg patriarchaler Geschichte, eigentlich umgehen wollen. Für „Würzburg liest ein Buch“ heißt das z. B. meiner Meinung nach, dass man nach dieser Aktion, bei der nach vier Werken von Männern zum ersten mal das einer Frau in den Mittelpunkt gesellt wurde, nicht mehr unhinterfragt und ohne eine bewusste Auseinandersetzung mit dieser Problematik in den früheren Modus zurückkehren kann. Aber auch das verdient noch mal eine eigene Würdigung, die ich nachschieben muss.
Elisabeth Dauthendey hat im Jahr 1900 ein Buch geschrieben mit dem Titel „Vom neuen Weibe und seiner Liebe“. Darin beschreibt sie den Mann als noch nicht reif für die moderne Frau. Hat sich da etwas geändert?
Das ist wirklich schwer zu beantworten, weil die Zeiten ja nicht vergleichbar sind. Aber ein paar Gedanken dazu:
Diese Diskrepanz kennen wahrscheinlich Feministinnen zu allen Zeiten, und je progressiver sie sind, um so mehr. Nicht allen Männern gegenüber natürlich, aber vielen. Und übrigens auch Frauen gegenüber, auch das hat Elisabeth Dauthendey geschildert. Aus diesem Buch strömt eine unglaubliche Einsamkeit, und ich glaube, das wiederum ist heute deutlich anders: Heute finden sich mehr Gleichgesinnte, unter Frauen wie Männern.
Was unsere Gegenwart betrifft: Ich glaube, die Schere geht heute auseinander, gerade unter den Männern. Einerseits gibt es mehr Männer, die sich für feministische Themen und Debatten interessieren, nicht zuletzt weil sie das alte, patriarchal geprägte Männerbild als einschränkend für ihre eigene Freiheit empfinden und der Meinung sind, dass auch für sie die gemeinsam gestaltete Welt etwas Gutes verspricht. Und andererseits gibt es diejenigen, die an diesem alten Männerbild festhalten, sich stark damit identifizieren und die die immer selbstbewusster auftretenden Frauen als Bedrohung wahrnehmen.
Insofern findet in unserer Gegenwart beides zugleich statt: Ein großer, selbstbewusst auftretender Veränderungswille und gleichzeitig ein immer heftigerer Backlash dagegen. Entsprechend groß ist die Schere gerade auch bei den Männern.
Glaubst du, mit Texten kann die Welt verbessert werden?
Ich glaube, die Wirkung einzelner Personen, Taten und Werke wird insgesamt oft überschätzt. Aber Literatur kann gesellschaftliche Strömungen oder Haltungen stützen und verstärken, im Guten wie im Schlechten, bewusst oder unbewusst. Und insofern trägt sie auch Verantwortung.
Soweit meine langen Antworten zu kurzen Fragen.
Das Stück „Hannah & Elisabeth“ entstand anlässlich von „Würzburg liest ein Buch“ und wurde initiiert von Würzburg liest e. V. und pics4peace e. V. in Kooperation mit den Juristen Alumni Würzburg e. V.